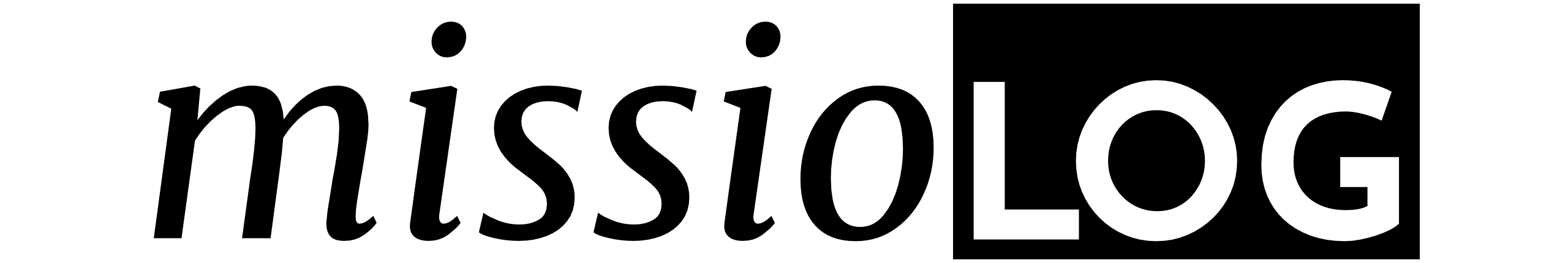Der Tod des amerikanischen Missionars John Allen Chau am 16. November 20181https://edition.cnn.com/2018/11/21/us/missionary-john-chau/index.html schlug hohe Wellen in der Berichterstattung und stieß auf ein geteiltes Echo. John hatte sich über Jahre vorbereitet, einem abgeschiedenen Ureinwohner Stamm auf einer indischen Insel das Evangelium zu verkünden. Beim zweiten Versuch mit einem Boot auf die Insel zu gelangen, wurde er von den Ureinwohnern getötet. Die Polizei erklärt, dass es verboten sei, sich bis auf 5 km der Insel zu nähern. Sie sahen keine Möglichkeit die Leiche zu bergen, aufgrund der extremen Feindseligkeit der Ureinwohner gegenüber fremden Eindringlingen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker beurteilte das Vorgehen des Amerikaners als „grob leichtsinnig“ und kritisierte sein Bestreben scharf, gezielt versucht zu haben, die Ureinwohner zu bekehren.2https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Missionar-getoetet-Streit-um-Umgang-mit-Urvoelkern,missionar100.html Sie fordern, die 170 isolierten Urvölker der Welt einfach in Ruhe zu lassen.
Kai Küstner, NDR Info, bringt es auf den Punkt:
„War John Allen Chau ein Besessener, eine Ausgeburt westlichen Hochmuts gar, eine Art „tragischer Kreuzritter“? Oder ist er ein Mann, der heldenhaft für seine Überzeugungen eintrat und dafür sogar zu sterben bereit war? Das hängt gänzlich vom Blickwinkel ab.“
Die Frage der ZEIT, ob man mit Chau Mitleid haben sollte, wird in den Kommentaren zum Teil hämisch verneint. Sie bringen einige der Vorurteile der westlichen, säkularisierten Gesellschaft gegenüber Mission zum Vorschein.
1. Mission ist „Gehirnwäsche“
Menschen, die mit einem Sendungsbewusstsein missionarisch unterwegs sind, werden kritisch beäugt und schnell als arrogant und intolerant wahrgenommen.
Kann es in einer komplexen und bunten Welt überhaupt so etwas wie Wahrheit und das Richtige geben? Ist nicht alles relativ? Dieser Grundsatz des reflektieren modernen Menschen wird durch jede Form der Mission erschüttert und in Frage gestellt. Wenn alles relativ ist und jeder nach seiner eigenen Fasson glücklich werden kann, dann ist Mission im günstigsten Fall bevormundend für Menschen, die nicht reflektiert oder reif genug sind, ihren eigenen Weg und Sinn zu definieren. Oder im schlimmeren Fall gar manipulativ, indem es Menschen ködert, hinters Licht führt und ausnutzt.
Diese Vorwürfe lassen sich mit zahlreichen Beispielen aus der Missionsgeschichte illustrieren – nicht nur der christlichen, sondern jeder Religion und Ideologie, die missionarisch aktiv geworden ist. Ja, sogar ein Großteil unserer Werbung wird sich nur schwer dieser Vorwürfe erwehren können.
Ich möchte daher nicht versuchen sämtliche Beispiele für Gehirnwäsche, Manipulation, Arroganz und Bevormundung in der christlichen Missionsgeschichte zu widerlegen oder zu relativieren. Stattdessen möchte ich kurz aufzeigen, dass christliche Missionsarbeit nicht manipulativ sein muss und – nimmt man den Auftrag Jesu ernst – nicht manipulativ sein darf.
Dass das Evangelium von Jesus Christus besonders anziehend ist für Arme und Benachteiligte wird man ihm wohl kaum zum Vorwurf machen können. Auch lässt das recht verstandene Evangelium keinen Raum für Arroganz. Fordert es doch von jedem Christen zuerst und vor allem, einzugestehen, dass kein Mensch gut genug vor Gott und seinem eigenen Maßstab sein kann. Deshalb ist jeder auf Gottes unverdiente Barmherzigkeit angewiesen. Wie jedes Weltbild ruht der christliche Glaube auf einigen Grundlagen, die weder bewiesen noch widerlegt werden können. Dazu gehört der Glaube an den Schöpfer-Gott, der sich in der Bibel offenbart und durch Jesus Christus einen Heilsweg geschaffen hat, der nun allen Menschen gilt. Auf der Grundlage dieser Annahme entwickelt sich ein Weltbild und ethisches Lebensmodell, dass in sich rational und in der Praxis erwiesen – sich interkulturell fruchtbar entfaltet hat. Selbst unter Verfolgung und Gefahren halten heute Million von Christen in aller Welt an ihrem Glauben fest, während große Ideologien, wie z.B. der Kommunismus in der Sowjetunion oder der Islamismus im Iran bereits binnen weniger Generationen zerbröselt sind.
Der christliche Glaube hat einen universellen Anspruch, setzt aber in der Mission ausschließlich auf Überzeugung und Konversion, die auf einer persönlichen, bewussten und freiwilligen Entscheidung basiert. Insbesondere die freikirchlich-protestantische Mission fordert diese freiwillige Entscheidung des Einzelnen und wendet sich gegen jede Form von Manipulation und Machtmissbrauch bei der Konversion. Missionare investieren oft Jahre in Sprachstudium, theologische Ausbildung und Kontextualisierung, damit sie Menschen das Evangelium so verständlich machen können, dass sie es verstehen und aus freien Stücken eine Entscheidung treffen können. Neue Gläubige werden dann in einem weiteren Prozess begleitet, um die Grundlagen des christlichen Glaubens kennenzulernen, zu verstehen und anwenden zu lernen, bevor sie sich taufen lassen und verbindlich Mitglieder einer Kirchengemeinde werden. Das gleiche gilt auch für ihre eigenen Kinder.
2. Mission zerstört Kulturen
Überall dort, wo der christliche Glaube Fuß fasst, verändern sich die Menschen und mit ihnen auch Gesellschaften. Das lässt sich bereits in den Missionierungsberichten des Neuen Testaments nachlesen. Ein eifriger Christenverfolger wird zum größten Heidenmissionaren, Besessene werden frei, soziale Grenzen werden in der christlichen Gemeinde überbrückt.
Außerdem ist es auch ein Imperativ, den beispielsweise Paulus, der größte Heidenmissionar, der christlichen Gemeinde in Rom mitgibt: „Ändert euch in eurem Denken!“ (Röm. 12) Besonders heidnische Riten und Gebräuche sollen gemieden werden, die in den meisten Kulturen den Kern bilden. Z.B. das Verbot Götzenopferfleisch zu essen und an den üblichen Opferritualen in heidnischen Tempeln teilzunehmen. Oder auch die Verweigerung des Kaiserkults, der die Christen zur Zielscheibe des Römischen Imperiums werden ließ.
Zugleich bringt der christliche Glaube kaum feste, eigene kulturelle Formen mit, die eine genuin eigene Kultur prägen könnte. Ganz im Gegenteil – wie oben schon festgestellt – ist das Christentum die einzige Weltreligion, die tatsächlich auf allen Kontinenten Fuß gefasst hat und dabei zugleich eine große kulturelle Vielfalt beibehalten oder gar gefördert hat. Trotz über tausendjähriger Herrschaft der römisch-katholischen Kirche in Europa mit lateinischer Messe und Länder übergreifenden Verbindungen sowie kulturellem Austausch, bildet Europa immer noch einen großen bunten Teppich an Bräuchen, Sprachen und Traditionen. Ja, die heute noch prägenden kulturellen Normen sind gerade durch den christlichen Glauben entstanden oder erhalten geblieben: Die Sprache durch die Bibelübersetzungen; Weihnachten, Ostern und selbst der Karneval ist geprägt von der christlichen Fastenzeit.
Wir müssen also festhalten: Die Verbreitung des christlichen Glaubens verändert Menschen, Gewohnheiten und Kulturen. Sie wendet sich gegen heidnische Bräuche und Riten, stülpt ihnen jedoch keine eigene „christliche“ Kultur über, sondern prägt mit ihren Glaubenssätzen und ethischen Normen neue, aber nichtsdestotrotz eigenständige Kulturen.
Ein besonderes Augenmerk soll nun noch mal auf die indigenen Völker gerichtet werden, da ihre Missionierung – wie im eingangs angeführten Beispiel – am stärksten in der Kritik steht. Hier gilt es zuerst festzuhalten, dass im letzten Jahrhundert ein entscheidender Paradigmenwechsel stattgefunden hat, der diese Frage erst erzeugt hat: Von einer durch Technik und Fortschritt geprägten Weltsicht, in der den „rückständigen“ Völkern der Fortschritt und damit das Gute Leben gebracht werden muss, zu einer naturalistischen Weltsicht, in der indigene Völker aufgrund ihrer Unberührtheit von „Technik“, Industrialisierung und komplexen Machtgefügen idealisiert werden. Der Paradigmenwechsel entstand aus der grausamen Erfahrung zweier industriell geführter Weltkriege, die von technischem Fortschritt und „zivilisatorischen“ Errungenschaften nicht verhindert, sondern gar erst befeuert wurden. Also richtete sich der Blick wieder den Völkern und Menschen zu, die einfach und „natürlich“ lebten.
Warum lässt man Menschen, die bereits in einer paradiesischen und heilen Welt leben, nicht einfach in Frieden? Oder versucht durch sehr vorsichtige Beobachtung und Teilhabe an diesen Kulturen sogar etwas zu lernen und für komplexe moderne Gesellschaften fruchtbar werden zu lassen, wie es seit etwa hundert Jahren Anthropologen versuchen?
Das Menschen in indigenen Völkern zum großen Teil keinesfalls in einer „heilen“ Welt leben, wird leicht übersehen, wenn man diese Menschen „einfach in Frieden lässt“. Die verschiedenen Stämme in Papua-Neuguinea z.B. rotten sich durch ständige Fehden und Rachefeldzüge zum Teil selbst gegenseitig aus. Erst der christliche Glaube hat diesen Stämmen dauerhaften Frieden und damit auch ein sichereres und besseres Leben ermöglicht. Oder denken wir an die grausamen Riten der Mädchenbeschneidung in afrikanischen indigenen Völkern. Dort kommen Menschen aus den eigenen Reihen dieser Völker auf Christen zu und bitten sie, in ihre Stämme zu kommen und ihnen durch Mission und sozial-diakonische Dienste zu helfen, diesen kulturellen Teufelskreislauf zu durchbrechen. Sie erhoffen sich durch die Gründung christlicher Gemeinden und die Einrichtung von Mädchenhäuser Sicherheit und Schutz für ihre Familien und für die von der Beschneidung bedrohten Kinder.
Eine letzte Bemerkung betrifft die Sprache. Während die Globalisierung und vor allem die weltweite Vernetzung so gut wie aller Menschen immer mehr Sprachen und Dialekte aussterben lässt, bemühen sich heute tausende von Missionaren darum, über Jahrzehnte indigene Sprachen zu erlernen, Kulturen zu verstehen und ihnen in ihrer Sprache die Bibel und christliche Lehre zu vermitteln. Bibelübersetzungen und kontextualisierte Missionierung sind in vielen Fällen der einzige Rettungsanker zum Erhalt indigener Sprachen und ihren entsprechenden kulturellen Eigenheiten.
3. Missionierende Religionen sind gewaltbereit und führen zu Religionskriegen und Konflikten
Dieses Vorurteil klingt nur zu plausibel im Erfahrungshorizont von islamistischem Terror und im Blick auf die christlichen Kreuzzüge des Mittelalters. Schaut man sich die Konflikte jedoch genauer an, stellt man schnell fest, dass die tatsächlichen Gründe für Krieg und Gewalt vor allem politischer und wirtschaftlich Natur sind. Die religiösen Begründungen dienten meist nur als Deckmantel zur Verschleierung der machtpolitischen Interessen oder zur Mobilisation in den eigenen Reihen.
Während man beim Islam zumindest die Feldzüge und das Machtgebaren des Gründers Mohammed ins Feld führen könnte, bleibt dies im Christentum strickt verwehrt. Einen Religionsgründer, der sich selbst unschuldig ans Kreuz schlagen lässt und schon zu Lebzeiten das Gebot der Feindesliebe gepredigt hat, lässt sich nur schwer für gewalttätige Missionierung ins Feld führen.
Das christliche Missionierung – auch mit Gewalt – stattgefunden hat, ist ein trauriges Kapitel der Kirchengeschichte und zeigt, wie korrumpierend Macht und Geld auch auf Christen wirken können. Mit der Idee und den Werten des christlichen Glaubens, wie sie von Jesus gelehrt und in der Bibel festgehalten sind, lässt sich dies nicht vereinen.
Die christlichen Werte von Nächstenliebe, Feindesliebe, Demut und Friedfertigkeit haben hingegen überall dort, wo sie Wurzeln schlagen konnten, zu mehr Frieden, Sicherheit und nicht selten Wohlstand der Gesellschaft geführt.
Ein ganz anderes grausames Kapitel ist die Gewalt gegen Christen. Keine andere Weltreligion hat so dauerhaft und global eine so starke Verfolgung und Bedrohung erfahren, wie das Christentum. Zugleich wächst die Kirche auch und gerade in Gegenden, wo es alles andere als opportun ist, Christ zu werden. Bis auf wenige historische und lokale Gegenbeispiele muss man anerkennen, dass dort, wo Christen in der Minderheit sind, christliche Gemeinschaften trotz Verfolgung und Unterdrückung wachsen und blühen und dort, wo sie die Mehrheit der Gesellschaft bilden, auch andersgläubige in Frieden und Sicherheit gleichberechtigt leben können.
Hier ist John Allen Chau wieder ein Beispiel für einen Menschen, der selbst unbewaffnet, den Mut aufbringt den Kontakt zu einer Menschengruppe aufzunehmen, von der er befürchten musste, umgebracht zu werden. Er nahm dieses Risiko in Kauf, um den Menschen, die ihn töteten, die Möglichkeit zu geben, den christlichen Glauben kennenzulernen.
Bist du diesen oder ähnlichen Vorurteilen auch schon begegnet? Gibt es Vorurteile, die ich nicht erwähnt oder ausreichend beantwortet habe? Was hält dich davon ab, Teil von Gottes Mission in der Welt zu werden?